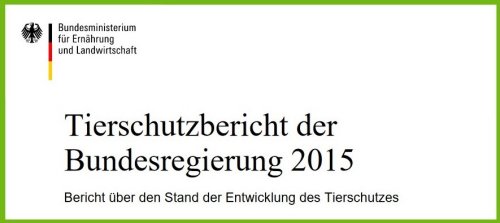
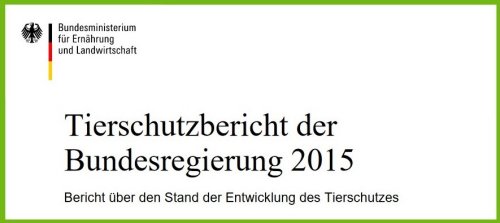 |
| Auszug aus dem Tierschutzbericht 2015 |
|
Der
Tierschutzbericht 2015 ist der Bericht über den Stand der
Entwicklung des Tierschutzes in der Bundesrepublik Deutschland. Ihm
liegt ein Berichtszeitraum von vier Jahren (2011–2014) zugrunde. Der
Bericht wurde vom Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) herausgegeben und auch im Internet veröffentlicht. Er umfasst 14 Kapitel auf 136 Druckseiten.
Kapitel
2 ist der Tierhaltung gewidmet. Textziffer 2.10 berichtet über die Lage der Tierheime. |
|
2.9. Heimtiere Bestandteil
der BMEL-Tierwohlinitiative (s. Kap. 1) sind auch Maßnahmen
zur
Verbesserung des Tierschutzes bei den so genannten
„Begleittieren“.
Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf der Haltung von exotischen
Tieren und Wildtieren in Privathand, bei der über Tierschutz-
und
Artenschutzprobleme berichtet wird. Valide Daten sind allerdings
nicht verfügbar. Um einen Überblick über die
Situation und
bestehende Probleme zu gewinnen, hat das BMEL ein entsprechendes
Forschungsprojekt in Auftrag gegeben. Das Forschungsprojekt soll
Aufschluss darüber geben, welche Maßnahmen zur
Verbesserung des
Tierschutzes bei der Haltung von exotischen Tieren und Wildtieren in
Privathaushalten erforderlich und geeignet sind. Ergebnisse werden
voraussichtlich Ende 2016 vorliegen.
2.9.1. Verbesserung der Sachkunde der Heimtierhalter Nach § 2 Nummer 3 des Tierschutzgesetzes muss derjenige, der ein Tier hält oder betreut, über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Denn wenn die geforderte Sachkunde nicht in ausreichendem Maß vorhanden ist, können tierschutzwidrige Haltungsbedingungen die Folge sein. Um
die geforderte Sachkunde zu verbessern, wurde mit dem Dritten Gesetz
zur Änderung des Tierschutzgesetzes eine Pflicht zur
Übergabe von
schriftlichen Informationen über die wesentlichen
Bedürfnisse des
Tieres an den Käufer vorgeschrieben (§ 21 Absatz 5
Nummer 2 des
Tierschutzgesetzes). Seit dem 1. August 2014 hat danach derjenige,
der gewerbsmäßig mit Wirbeltieren (ausgenommen
landwirtschaftlichen
Nutztieren) handelt, sicherzustellen, dass bei der erstmaligen Abgabe
eines Tieres einer bestimmten Art an den jeweiligen künftigen
Tierhalter mit dem Tier schriftliche Informationen über die
wesentlichen Bedürfnisse des Tieres, insbesondere im Hinblick
auf
seine Ernährung und Pflege sowie verhaltensgerechte
Unterbringung
und artgemäße Bewegung, übergeben werden.
Dies gilt nicht bei der
Abgabe an einen anderen gewerbsmäßigen
Händler.
Tierhalter
werden durch diese Maßnahme beim Erwerb von Tieren besser
über die
Bedürfnisse der Tiere informiert, damit tierschutzwidrige
Haltungsbedingungen aufgrund mangelnder Sachkunde nach
Möglichkeit
verhindert werden. Gegebenenfalls müssen weitere Anstrengungen
unternommen werden, künftige Tierhalter noch besser
über das zu
haltende Tier zu informieren.
2.9.2. Hunde 2.9.2.1. Illegaler Welpenhandel Beim
illegalen Handel mit Hunden, insbesondere Hundewelpen, finden
Aufzucht, Handel und Transport unter tierschutzwidrigen Bedingungen
statt. Wer
in Deutschland gewerbsmäßig mit Wirbeltieren
handelt, bedarf einer
tierschutzrechtlichen Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz 1
Nummer 8
Buchstabe b des Tierschutzgesetzes. Die Erlaubnis wird durch die
zuständige Behörde erteilt, wenn die
persönlichen (fachliche
Kenntnisse und Fähigkeiten, Zuverlässigkeit) sowie
sachlichen
Voraussetzungen (geeignete Räume und Einrichtungen) vorliegen.
Bei
Haltung und Betreuung der Tiere sind die Anforderungen des § 2
Tierschutzgesetz zu beachten. Danach muss derjenige, der ein Tier
hält, betreut oder zu betreuen hat, das Tier seiner Art und
seinen
Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren,
pflegen und
verhaltensgerecht unterbringen. Für die Haltung von Hunden
gilt
ergänzend die Tierschutz-Hundeverordnung. Eine
Maßnahme gegen den illegalen Welpenhandel ist die Erweiterung
der
Erlaubnispflicht auf das Verbringen und die Einfuhr von Wirbeltieren
(außer Nutztieren) zum Zwecke der Abgabe gegen Entgelt oder
eine
sonstige Gegenleistung (§ 11 Absatz 1 Nummer 5 des
Tierschutzgesetzes), die mit dem Dritten Gesetz zur Änderung
des
Tierschutzgesetzes erfolgt ist. Die Erlaubnispflicht gilt auch
für
die Vermittlung solcher Tiere gegen Entgelt oder eine sonstige
Gegenleistung. Da diese Regelung nicht voraussetzt, dass
gewerbsmäßiger Handel vorliegt, sondern ein Handeln
gegen Entgelt
oder eine sonstige Gegenleistung ausreicht, können die
Vollzugsbehörden in mehr Fällen der Einfuhr oder des
Verbringens
von Hunden aus dem Ausland als bisher tätig werden, das
Vorliegen
einer Erlaubnis fordern und dabei das Vorliegen der
Erlaubnisvoraussetzungen überprüfen.
Verstöße gegen
tierschutzrechtliche Bestimmungen können durch die erweiterte
Erlaubnispflicht besser festgestellt und geahndet werden.
Als weitere Maßnahme hat das BMEL am 30. Mai 2014 einen „Runden Tisch“ zur Problematik des illegalen Welpenhandels veranstaltet. Im Rahmen dieser Veranstaltung haben sich Vertreter von Tierschutzverbänden, Vollzugsbehörden, des Zoofachhandels, der Hundezucht und der Tierheime erstmals über laufende und künftige Initiativen und mögliche Schritte zur Eindämmung des illegalen Welpenhandels ausgetauscht. Die Teilnehmer sahen in der besseren Aufklärung der Hundekäufer eine wesentliche Vorkehrung gegen den illegalen Welpenhandel. Das BMEL hat bereits auf seiner Internetseite einen Informationstext zum illegalen Welpenhandel veröffentlicht, der Hundekäufern Hinweise auf unseriöse Praktiken gibt. Ein anderer Vorschlag der Teilnehmer bezog sich auf die Erarbeitung eines Leitfadens für die Vollzugsbehörden zum Umgang mit Fällen von illegalem Welpenhandel. Das BMEL hat die Gründung einer Länderarbeitsgruppe angestoßen und koordiniert deren Arbeit, einen entsprechen-den Leitfaden zu entwickeln. Für wichtig wurde von den Teilnehmern außerdem ein stärkerer Austausch zwischen den Mitgliedstaaten zu Fällen von illegalem Welpenhandel gehalten. Das BMEL wird den Austausch mit anderen Mitgliedstaaten zu der Problematik forcieren. 2.9.2.2. Erlaubnispflicht für die gewerbsmäßige Hundeausbildung Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes wurde eine neue Erlaubnispflicht für die gewerbsmäßige Hundeausbildung eingeführt, die seit dem 1. August 2014 gilt. Nach § 11 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe f des Tierschutzgesetzes bedarf derjenige, der gewerbsmäßig für Dritte Hunde ausbildet oder die Ausbildung der Hunde durch den Tierhalter anleitet, der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnispflicht wurde eingeführt, da Hundeschulen einen wesentlichen Einfluss auf eine tierschutzgerechte Ausbildung von und den tierschutzgerechten Umgang mit Hunden haben. Mit der neuen Regelung sollen Mindestqualitätsstandards im Hin-blick auf tierschutzrelevante Kenntnisse und Fähigkeiten der Ausbilder sichergestellt werden. Die
Anforderungen an die Erteilung einer Erlaubnis sind in § 11
Absatz 1
Satz 2 und 3 sowie Absatz 2 und 2a des Tierschutzgesetzes in der bis
zum 13. Juli 2013 geltenden Fassung festgelegt. Von
Seiten der Hundeausbilderinnen und Hundeausbilder wurde nach
Inkrafttreten der Regelung Kritik daran geübt, dass
Vollzugsbehörden
teilweise unterschiedliche Maßstäbe an die als
Voraussetzung für
die Genehmigung erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten
anlegen.
Die Erteilung der Genehmigung ist jedoch immer eine
Einzelfallentscheidung der Behörde, bei der die
Behörde die
jeweiligen Umstände zu prüfen und auf dieser
Grundlage zu
entscheiden hat.
Um auf eine möglichst einheitliche Vollzugspraxis hinzuwirken, hat das BMEL die Erarbeitung von Vollzugsempfehlungen angestoßen, die das Erlaubnisverfahren angleichen sollen. So wurde in einer Arbeitsgruppe der Länder unter Koordinierung des BMEL ein Frage-Antwort-Dokument erarbeitet, das den Behörden Hilfestellung im Erlaubnisverfahren geben soll. Das Dokument wurde von der Arbeitsgemeinschaft Tierschutz der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) im Mai 2014 beschlossen. Das
Tierschutzgesetz sieht in § 11 Absatz 2 in der seit dem 13.
Juli
2013 geltenden Fassung die Möglichkeit vor, die
Voraussetzungen und
das Verfahren für die Erlaubniserteilung durch
Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zu regeln. Dies betrifft alle nach
§ 11
des Tierschutzgesetzes erlaubnispflichtigen Tätigkeiten,
darunter
auch die gewerbsmäßige Hundeausbildung. Es wird
geprüft, ob das
Genehmigungsverfahren für die Tätigkeit der
Hundeausbildung im Zuge
einer künftigen Änderung der
Tierschutz-Hundeverordnung geregelt
werden könnte und sollte.
2.9.2.3. Änderung der Tierschutz-Hundeverordnung In der Tierschutz-Hundeverordnung waren redaktionelle Anpassungen an die mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes erfolgten Änderungen im Tierschutzgesetz erforderlich. Diese Anpassungen sind mit Artikel 3 der Verordnung zur Ablösung der Versuchstiermeldeverordnung und zur Änderung tierschutzrechtlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2013 erfolgt. Im Zuge der Änderung wurde insbesondere § 10 Satz 1 der Tierschutz-Hundeverordnung dahingehend ausgeweitet, dass künftig von einem Ausstellungsverbot auch solche Tiere betroffen sind, bei denen tierschutzwidrige Amputationen aus anderen Gründen als zum Erreichen bestimmter Rassemerkmale vorgenommen wurden. 2.9.3. Katzen Mit
dem Dritten Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes wurde
der
Tierschutz bei herrenlosen, verwilderten Katzen verbessert. Katzen
ohne menschliche Obhut und Versorgung erfahren häufig
Schmerzen,
Leiden oder Schäden in teilweise erheblichem Ausmaß,
da es sich um
Tiere einer domestizierten Art handelt, die nicht an ein Leben ohne
menschliche Unterstützung angepasst sind. Die
Regelung bezieht sich nicht auf die herrenlosen Tiere selbst, sondern
auf die in einem Besitzverhältnis stehenden Katzen und
entspricht -
wenn von der Verordnungsermächtigung Gebrauch gemacht wird -
de
facto einer Kastrationspflicht für Haus- und Hofkatzen mit
Freigang. Zahlreiche
Berichte von Städten, Gemeinden, Kommunen und
Behörden, von
Tierschutzorganisationen und in den Medien zeugen davon, dass auch in
Deutschland Kolonien herrenloser, verwilderter Katzen zunehmen.
Verlässliche Informationen über die Zahl solcher
Tiere in
Deutschland existieren nicht, Erhebungen haben aber gezeigt, dass die
Problematik regional unterschiedlich ausgeprägt ist und
örtlich
begrenzt aus Gründen des Tierschutzes Handlungsbedarf besteht. International
wird die gezielte Populationskontrolle durch das Einfangen, die
tierärztliche Versorgung, die Kastration und das Freisetzen an
der
Einfangstelle mit nachfolgender Betreuung (Fütterung,
tierärztlicher
Versorgung) als erfolgversprechender Ansatz zur Lösung der
Problematik angesehen. Die konsequente Durchführung dieses
Ansatzes
(Einfangen - Kastrieren - Freisetzen) führt zu stabilen
Gruppen mit
mittelfristig abnehmenden Tierzahlen und einer Verbesserung des
Wohlbefindens der Tiere. Jährlich
werden in Deutschland auf diese Weise bereits mehrere Tausend Tiere
kastriert. Dabei hat sich jedoch gezeigt, dass der Erfolg dieser
Maßnahme nicht nachhaltig ist, wenn aus den Reihen der in
einem
Besitzverhältnis stehenden Hauskatzen unkastrierte Tiere
zuwandern
bzw. die Fortpflanzungskette aufrecht erhalten. Zudem wird für
den
ungewollten Nachwuchs auch von Hauskatzen häufig keine
Verantwortung
übernommen, sondern die Katzen werden sich selbst
überlassen und
stellen den Ausgangspunkt für neue Kolonien verwilderter
Katzen dar.
Deswegen kann es als zusätzliche Maßnahme erforderlich sein, den unkontrollierten freien Auslauf fortpflanzungsfähiger Haus- und Hofkatzen für einen bestimmten Zeitraum zu beschränken oder zu verbieten. Kastrierte Katzen sind von dieser Regelung nicht betroffen. Da
die Problematik in Deutschland regional in unterschiedlichem
Ausmaß
auftritt, wäre eine bundesweite Regelung
unverhältnismäßig. Nur
wo nachweislich eine entsprechende Problematik besteht, sind
entsprechende Regelungen erforderlich. Ob Regelungen erforderlich und
verhältnismäßig sind, müssen die
Landesregierungen für ihre
jeweiligen Gebiete entscheiden und begründen. Die
Landesregierungen
können die Ermächtigung zum Erlass derartiger
Regelungen auch auf
nachgeordnete Behörden übertragen.
2.10. Lage der Tierheime Tierheime leisten durch die Aufnahme, die Pflege, die Betreuung und die Weitervermittlung von Fundtieren, herrenlosen oder abgegebenen sowie sichergestellten Tieren einen bedeutenden Beitrag zum Tierschutz vor Ort. Jedoch reichen die finanziellen Mittel für die übernommenen Aufgaben teilweise nicht aus. Von den Tierschutzvereinen, die Tierheime betreiben, wird insbesondere die Kostenerstattung für die Unterbringung von Fundtieren als unzureichend kritisiert. Tiere sind nach § 90a des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) keine Sachen, jedoch sind die für Sachen geltenden Vorschriften regelmäßig entsprechend anzuwenden. So gelten die Bestimmungen zu Fundsachen (§§ 965 ff. BGB) auch für Fundtiere. Fundtiere sind üblicherweise vom Menschen gehaltene Tiere, die der Eigentümer verloren hat, die also nicht mehr in dessen Besitz sind, z. B. ein entlaufenes Tier. Aufgrund ihrer Verwahrungspflicht (§§ 966 Absatz 1, 967 BGB) müssen die zuständigen Behörden der Kommunen die Kosten für die Unterbringung im Tierheim übernehmen. Die Fundtierbetreuung stellt eine kommunale Pflichtaufgabe dar. Tiere, die keinen Eigentümer haben (z. B. verwilderte Katzen) oder deren Eigentum erkennbar aufgegeben wurde (ausgesetzte Tiere), sind herrenlose Tiere, unterfallen also nicht dem Fundrecht. Für diese Tiere besteht grundsätzlich keine rechtliche Verpflichtung der Kommunen, die Kosten für die Unterbringung in Tierheimen zu übernehmen. Kosten für sichergestellte Tiere, z. B. aufgrund von Gefährlichkeit, Misshandlungen oder in Fällen von Animal Hoarding (= krankhafte „Tiersammelsucht“), trägt der Eigentümer. Häufig ist dieser illiquide. In diesen Fällen trägt die für den Vollzug des Tierschutzgesetzes zuständige Behörde die Kosten. Von den Tierschutzvereinen wird kritisiert, dass die Kommunen häufig Fundtiere mit der Begründung nicht als solche anerkennen, dass es sich um herrenlose Tiere handele. Sofern Fundtiere überhaupt als solche anerkannt werden, werde oftmals die nach BGB vorgesehene Verwahrungsdauer von sechs Monaten von den zuständigen Behörden nicht eingehalten. In der Regel werden die Tiere nach vier Wochen wie herrenlose Tiere behandelt, d. h. Tierheimen werden die entstehenden Kosten für die Unterbringung danach nicht mehr erstattet. Das Verwaltungsgericht Lüneburg hat hierzu mit Beschluss vom 13. Dezember 2013 festgestellt (4 K 29/13), dass Katzen grundsätzlich als Haustiere gehalten werden und daher keine Wildtiere sind. Bei aufgefundenen Haustieren bestehe die Regelvermutung, dass diese nicht ausgesetzt worden seien, da dies nach § 3 Nummer 3 des Tierschutzgesetzes verboten sei. Bei aufgefundenen Katzen ist daher ebenso wie bei Hunden und anderen Haustieren davon auszugehen, dass es sich um Fundtiere handelt. Der
Bundesrat hat die Bundesregierung 2011 in einer Entschließung
aufgefordert, bei der bevorstehenden Überarbeitung des
Tierschutzgesetzes eindeutige gesetzliche Regelungen für die
Betreuung und Unterbringung von verlorenen und entlaufenen sowie
ausgesetzten Tieren einzuführen (Bundesratsdrucksache 408/11),
um
die Kostentragungspflichten klar zu regeln. Mit
dem Dritten Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes wurden
aber
Maßnahmen getroffen, die indirekt zu einer Entlastung der
Tierheime
führen dürften. Dazu zählen die
Ermächtigung zur Anordnung
regional begrenzter Kastrations- und Kennzeichnungspflichten
für
freilaufende Katzen (§ 13b des Tierschutzgesetzes) und die
Pflicht
zur Übergabe von schriftlichen Informationen über die
wesentlichen
Bedürfnisse des Tieres im Rahmen des gewerblichen Handels
(§ 21
Absatz 5 Nummer 2 des Tierschutzgesetzes).
|